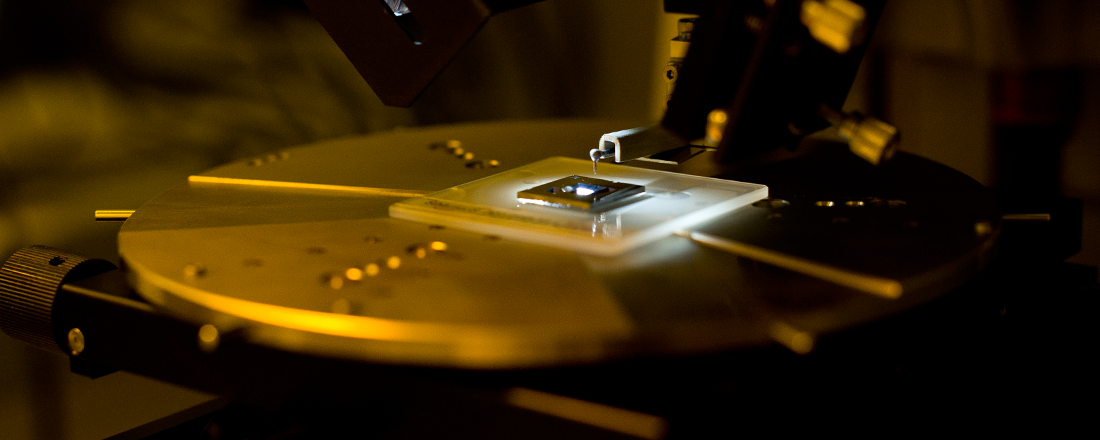Nach Abschluss des Projekts
Um die Auffindbarkeit und Nachnutzbarkeit der erhobenen Forschungsdaten auch über das Projektende hinaus zu ermöglichen, werden Maßnahmen zur Sicherung, langfristigen Speicherung und Veröffentlichung benötigt. Die Daten können als Grundlage oder Vergleichsmaterial für spätere Forschungsfragen dienen. Daher ist es wichtig, entstandene Daten langfristig auffindbar und den Entstehungskontext nachvollziehbar zu machen.
Forschungsdaten unterliegen im Projektverlauf Veränderungen, was durch ein effektives Datenmanagement unterstützt werden sollte: Ein qualitätsbewusster und verantwortungsvoller Umgang mit Forschungsdaten umfasst neben der sicheren Aufbewahrung (Backup) der Daten auch deren Anreicherung mit zusätzlichen Informationen (Metadaten), die die Daten und den Kontext der Entstehung bzw. Verarbeitung der Daten beschreiben. Am Ende eines Projekts sollten alle Daten in einer endgültigen Version vorliegen, in der sie für eine spätere Nachnutzung zur Verfügung gestellt werden können und möglichst standardisierte Formate verwenden, die in der jeweiligen Fachcommunity verbreitet sind. Um die Zugänglichkeit zu den Daten, die Interoperabilität mit anderen Systemen und die Langzeitverfügbarkeit von Forschungsdaten zu unterstützen, wird empfohlen, langfristig nutzbare Dateiformate zu verwenden (beispielsweise offene, nicht proprietäre Dateiformate).
Die Universität Bayreuth empfiehlt ihren Angehörigen, Forschungsdaten möglichst frühzeitig öffentlich zugänglich zu machen, soweit keine datenschutzrechtlichen, forschungsethischen, urheber- oder patentschutzrechtlichen Regelungen einer Veröffentlichung entgegenstehen (siehe Leitlinien).
Daten langfristig speichern
- Warum reicht ein Backup der Daten zur langfristigen Speicherung nicht aus?Einklappen
-
Aktuell verwendete Dateiformate können unter Umständen zukünftig nicht mehr zugänglich und interpretierbar sein. Damit gehen die erforschten Inhalte verloren, selbst wenn die physischen Daten (bitstream) noch vorhanden sind. Ein Backup sichert die Daten unabhängig von ihrem Zustand, auch beschädigte Dateien oder obsolete Formate. Bei einem Backup werden die Daten mit einem Minimalset an (technischen) Metadaten gespeichert Diese enthalten beispielsweise keine Informationen zum Entstehungskontext der Daten, was zur Formaterhaltung notwendig ist. Eine Langzeitarchivierung stellt dagegen sicher, dass Inhalte und Eigenschaften der archivierten Objekte systemunabhängig in Zukunft zur Verfügung stehen.
- Welche Möglichkeiten der langfristigen Speicherung gibt es an der UBT?Einklappen
-
Möchten Sie Ihre Forschungsdaten archivieren, steht Ihnen das Research Data Repositorium (RADAR) zur Verfügung. Die UBT verfügt über einen Vertrag für diese generische, disziplinübergreifende Dienstleistung. RADAR bietet eine zentrale Anlaufstelle zur Archivierung und Publikation vielfältiger Daten und Dateiformate. Da es disziplinübergreifend konzipiert wurde, gibt es keine Einschränkungen hinsichtlich der archivierbaren Dateiformate. Das reine Archivierungsangebot umfasst dabei die langfristige Speicherung paketierter Daten für eine vom Kunden festgelegte Haltefrist (5-15 Jahre). Nach Ablauf der Haltefrist kann diese verlängert oder die Daten gelöscht werden. Eine aktuelle Preisliste für die Archivierung Ihrer Daten in RADAR finden Sie auf der Webseite des Projekts.
Desweiteren befindet sich im Rahmen des Projekts "Digitale Langzeitverfügbarkeit im Bibliotheksverbund Bayern" des StMWK eine Infrastruktur zur langfristigen Speicherung von Forschungsdaten im Aufbau. Anders als bei RADAR wird hier, durch die Bereitstellung des im Rahmen des Projekts entwickelten Pre-Ingest Tools "FDOrganizer", die Ablieferung, Strukturierung und Anreicherung mit Metadaten der Forschungsdaten vereinfacht. Das Projekt sieht vor die Langzeitverfügbarkeit bei gesicherter Finanzierung bis zu einem unbegrenzten Zeitraum umzusetzen. Bei Interesse können Sie sich gerne an die Ansprechparter:innen an der UB wenden:
Robert Günther, robert.guenther@uni-bayreuth.de, 0921/55 3432
Alexandra Ullrich, alexandra.ullrich@uni-bayreuth.de , 0921/ 55 3950 - Wie kann ich Daten in RADAR archivieren?Einklappen
-
Bevor Sie Ihre Daten in RADAR archivieren können, müssen Sie diese mit zusätzlichen Informationen (Metadaten) anreichern und in sogenannte Ingest-Pakete schnüren. Für die Vergabe der Metadaten stellt der Dienst auf der RADAR-Plattform ein Formular bereit. Alternativ ist es möglich, die Metadaten offline als XML-Datei zu erstellen und dann auf die RADAR-Plattform hochzuladen. Das Zusammenstellen der Ingest-Pakete erfolgt über ein Webportal im temporären Speicher der RADAR-Plattform.
Zur Beantragung eines Zugangs zu RADAR wenden Sie sich bitte an das IT-Servicezentrum.
Daten teilen und veröffentlichen
Digitale Forschungsdaten können auf verschiedenen Wegen (öffentlich) zugänglich gemacht werden. Daten auffindbar, zugänglich und wiederverwendbar zu machen, sind wesentliche Bestandteile der „FAIR Prinzipien“.
Diese Empfehlungen stehen für einen planvollen und verantwortungsvollen Umgang mit Forschungsdaten (FAIR Data) und werden mittlerweile von vielen Forschungsförderern wie auch DFG oder EU befürwortet. Entsprechend des FAIR Data Konzepts sollten Forschungsdaten als auch die zugehörigen Metadaten auffindbar (Findable), zugänglich (Accessible), interoperabel (Interoperable) und nachnutzbar (Re-usable) sein.
Wie bei Artikeln ist auch bei einer Datenpublikation die eindeutige Verknüpfung von Publikation und ihren Autorinnen und Autoren mit der Universität Bayreuth für die Sichtbarkeit der Veröffentlichungen der Universität Bayreuth wichtig. Informationen und Empfehlungen zur standardisierten Angabe der Affiliation für Angehörige der Universität Bayreuth sind auf den Seiten der UB in der Publikationsrichtlinie „Die institutionelle Zugehörigkeit (Affiliation) bei deutsch- und englischsprachigen Publikationen“ zu finden.
- Was bedeutet FAIR Data?Einklappen
-
2016 wurden die Publikation „The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship“ veröffentlicht, die grundlegende Leitlinien für den FAIRen Umgang mit Forschungsdaten enthält. Die FAIR Prinzipien haben sich zum Standard für den Umgang mit Forschungsdaten entwickelt und werden von vielen Forschungsförderern unterstützt. FAIR steht dabei für die vier Prinzipien Findable, Accessible, Interoperable und Re-useable.
Weitere Informationen zur Umsetzung der FAIR Prinzipien finden sich beispielweise bei forschungsdaten.info, oder im OpenAIRE Leitfaden für Forschende "How to make your data FAIR", inklusive Checkliste zur Evaluierung der eigenen Daten hinsichtlich der FAIR Prinzipien. - Welche Möglichkeiten gibt es, Forschungsdaten zu veröffentlichen?Einklappen
-
Für die Veröffentlichung der Forschungsdaten gibt es verschiedene Optionen:
- eigenständig in einem Forschungsdatenrepositorium
- als Data Paper in einem Data Journal
- als Supplement zu einem Artikel
Forschungsdatenrepositorium: In einigen Fachbereichen stehen bereits etablierte Repositorien zur Verfügung, die in der Regel fachspezifische Standards oder Anforderungen, beispielsweise in Bezug auf die beschreibenden Informationen zu den Daten (Metadaten) etabliert haben. Daneben gibt es fachübergreifende, generische Repositorien, die Daten aus verschiedenen Disziplinen aufnehmen und daher häufig fachübergreifende (Metadaten-)Standards implementiert haben. Die Ablage der Daten in einem Repositorium unterstützt die Sichtbarkeit der Daten und damit der Forschungsleistung und verbessert ihre Referenzierbarkeit durch die Vergabe eines persistenten Identifikators (zum Beispiel DOI).
Data Paper: Ein Data Paper fokussiert auf die Beschreibung von Datensets, die idealerweise zitierbar mit einem persistenten Identifier (PID) in einem anerkannten Repositorium veröffentlicht werden und zudem direkt im Data Paper über den PID verlinkt sind. Typische Elemente sind neben Abstract und Einleitung eine strukturierte Beschreibung der Daten mit ergänzende Angaben zur Validierung des Datensets, Hinweisen zur Nachnutzung der Daten und zur Verfügbarkeit von Codes bzw. Software (Code Availability Statement). Data Paper können in einem fachspezifischen oder fachübergreifenden Data Journal veröffentlicht werden und unterliegen teilweise auch einem Peer Review Verfahren. Beispiele finden sich in der Data Journal Liste von Forschungsdaten.org
Supplement: Die Daten werden begleitend zu einem Forschungsartikel veröffentlicht. Sie können als Bestandteil des Artikels oder – bei neueren Publikationsmodellen – als eigenständig zitierbares Datenobjekt (mit PID) auf einem Repositorium veröffentlicht und über den PID mit der zugehörigen Publikation verlinkt werden.
Einige Verlage kooperieren mit Repositorien bei der Ablage von Forschungsdaten und bieten spezielle Konditionen (wie beispielweise eine kostenfreie Ablage) für die Veröffentlichung der Daten an. Bei einer Veröffentlichung sollte beachtet werden, dass Forschungsdaten auch dann zugänglich bleiben, wenn im Kontext der Publikation die Verwertungsrechte an den Verlag übertragen werden müssen (vgl. DFG-Leitlinien zum Umgang mit Forschungsdaten). - Welche Kriterien gibt es für die Auswahl eines geeigneten Repositoriums?Einklappen
-
Forschungsdatenrepositorien bieten unterschiedliche Funktionalitäten und sollten die spezifischen Anforderungen der Daten (Datenformat, Datenzugangsoptionen…) berücksichtigen. Folgende Kriterien können bei der Auswahl und Entscheidung für ein Repositorium helfen
- Ist das Repositorium im Fachbereich etabliert? In fachspezifischen Repositorien werden in der Regel die Standards der jeweiligen Fachdisziplin bei der Publikation von (Meta-)Daten berücksichtigt.
- Ist das Repositorium kostenfrei? Repositorien verfügen über unterschiedliche Kostenmodelle und bieten zum Teil eine kostenfreie Ablage bis zu einem begrenzten Datenvolumen an.
- Werden persistente Identifier (PID) vergeben? Diese unterstützen die Auffindbarkeit, Zitierbarkeit und Sichtbarkeit der Daten.
- Werden (fachspezifischen) Metadatenstandards genutzt? Geeignete Metadaten verbessern die Auffindbarkeit der Daten, stellen Informationen über die Forschungsdaten zur Verfügung, auch wenn diese selbst nicht (mehr) öffentlich verfügbar sind und ermöglichen den Verweis auf andere Objekte, wie Publikationen oder Daten.
- Welche Zugangsmöglichkeiten werden angeboten? Einige Repositorien bieten ausschließlich einen offenen Zugang an, andere auch die Option, Zugangsbeschränkungen oder Embargozeiten auszuwählen. Teilweise können Lizenzen für die Nachnutzung der Daten vergeben werden.
- Werden die Daten langzeitarchiviert? Manche Repositorien haben entsprechende Policies oder Richtlinien implementiert.
- Ist das Repositorium zertifiziert? Eine Zertifizierung kann die Entscheidung für ein Repositorium vereinfachen, da bestimmte Standards eingehalten werden (beispielweise das CoreTrustSeal für vertrauenswürdige Datenrepositorien oder das Nestor-Siegel für vertrauenswürdige digitale Langzeitarchivierung).
- Wie findet man ein geeignetes Repositorium?Einklappen
-
Die Auswahl eines geeigneten Repositoriums ist abhängig von den Anforderungen und Standards der jeweiligen Fachdisziplin. Neben den FAIR-Prinzipien sind auch die Anforderungen der Forschungsförderer, beispielsweise in Bezug auf Open Access oder Vorgaben der Journals zu berücksichtigen. Idealerweise vergibt das Repositorium einen persistenten Identifier für die Daten, der die Auffindbarkeit, Zitierbarkeit und Sichtbarkeit der Daten unterstützt und ermöglicht die Vergabe einer Lizenz, um die Bedingungen für die Nachnutzung der Daten zu regeln.
Bei der Suche nach geeigneten Repositorien unterstützen folgende Dienste:
- Registry of Research Data Repositories (Re3data.org): verzeichnet weltweit vorhandene Forschungsdatenrepositorien
- Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR): verzeichnet weltweit vorhandene Open Access Repositorien
- Informationsportal der DFG für Forschungsinfrastrukturen (RIsources): verzeichnet verschiedene wissenschaftliche Forschungsinfrastrukturen, unter anderem auch Forschungsdatenrepositorien
Sind geeignete, von der Community genutzte, fachspezifische Repositorien vorhanden, kann es sich anbieten, die Daten dort abzulegen, da in der Regel fachabhängige Standards umgesetzt sind, die zu einer besseren Sichtbarkeit, Auffindbarkeit und Nachnutzung der Daten beitragen. Bei speziellen Anforderungen und Fragen zur Auswahl eines Repositoriums unterstützen Sie die jeweiligen Ansprechpersonen aus dem FDM Team.
- Wie kann ich meine Daten außerhalb eines Fachrepositoriums publizieren?Einklappen
-
Gibt es in Ihrem Fachgebiet kein disziplinspezifisches Repositorium oder Data Journal zur Publikation der Daten, können Sie das Research Data Repositorium (RADAR) nutzen. Die UBT verfügt über einen Vertrag für diese generische, disziplinübergreifende Dienstleistung. Werden Daten über RADAR publiziert, bietet das System über die Oberfläche verschiedene Funktionalitäten, wie den Zugriff auf die Daten (Landing Page) und die Möglichkeit eines Peer Reviews für Forschungsdaten als eigenständige Publikation oder als Addendum zu einer klassischen Publikation. Für publizierte Daten gilt eine Haltefrist von mindestens 25 Jahren, wobei eine unbegrenzte Aufbewahrung angestrebt wird. Auf jeden Fall werden die Daten nicht gelöscht. Eine aktuelle Preisliste für die Publikation Ihrer Daten in RADAR finden Sie auf der Webseite des Projekts.
Bevor Sie Ihre Daten in RADAR publizieren können, müssen Sie diese mit Metadaten anreichern und in sogenannte Ingest-Pakete schnüren. Die Metadaten der publizierten Daten stehen unter einer CC0-Lizenz und sind u.a. über den DataCite-Metadatenstore abrufbar. Des Weiteren werden die Metadaten zum Harvesting via OAI-PMH zur Verfügung gestellt. Für die Vergabe der Metadaten stellt der Dienst auf der RADAR-Plattform ein Formular bereit. Alternativ ist es möglich, die Metadaten offline als XML-Datei zu erstellen und dann auf die RADAR-Plattform hochzuladen. Das Zusammenstellen der Ingest-Pakete erfolgt über ein Webportal im temporären Speicher der RADAR-Plattform.
Zur Beantragung eines Zugangs zu RADAR wenden Sie sich bitte an Dr. Thomas Martin vom IT-Servicezentrum.
- Was ist eine DOI und wie gelange ich an eine DOI für meine Daten?Einklappen
-
"Die Vergabe eines Digital Object Identifier (DOI) ermöglicht es, auf Objekte nachhaltig und eindeutig zuzugreifen. Ein DOI kann ähnlich einer ISBN zur Identifizierung eines Objektes eingesetzt werden und besitzt die Funktion, dieses zu lokalisieren. Auf diese Weise können wissenschaftliche Ergebnisse zuverlässig und in standardisierter Form zitiert werden." (Beschreibung aus: TIB Hannover - DOI-Service)
Sollten Sie zur Publikation Ihrer Daten, inklusive DOI-Vergabe kein zentrales (Fach)Repositorium nutzen können, bietet die UBT einen Server für Digitale Objekte (DO@UBT) an. Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihre Daten zu sichern und flexibel mit beschreibenden Informationen (Metadaten) zu hinterlegen. Zusätzlich dazu gibt es die Möglichkeit, derzeit noch manuell, DOIs für die dort publizierten Daten zu beantragen.
Die UBT besitzt einen Vertrag mit der TIB Hannover, wodurch wir eigene DOIs vergeben und dort registrieren können. Voraussetzung zur Vergabe einer DOI sind die Angabe beschreibender Informationen (Metadaten) zum Datenobjekt in Form einer XML-Datei (Schema und Beispiel) und die Angabe einer persistenten Landingpage als Übersichtsseite für die Datenobjekte.
Pflichtangaben für die Metadaten sind:
- Identifer
- Creator
- Title
- Publisher
- PublicationYear
- ResourceType
Die Angabe einer Landingpage für die Daten ist obligatorisch. Diese wird beim Auflösen der DOI aufgerufen und ist für jedermann frei zugänglich. Sie muss auch dann noch vorhanden sein, wenn das Objekt nicht mehr verfügbar oder der Zugang zu diesem nur restriktiv möglich ist.
Weitere Informationen zur individuellen DOI Vergabe an der UBT erhalten Sie bei Dr. Thomas Martin vom IT-Servicezentrum.
- Welche Lizenzierungsmöglichkeiten gibt es für eine Datenpublikation?Einklappen
-
Die Nach-Nutzung (Re-Use) von Forschungsdaten ist ein grundlegender Baustein der FAIR-Prinzipien. Lizenzen regeln die Bedingungen, unter denen Forschungsdaten geteilt und nachgenutzt werden können. Abhängig vom gewählten Repositorium können verschiedene Lizenzierungsoptionen zur Auswahl stehen oder auch eine bestimmte Lizenz vorgegeben sein.
Nicht immer sind Forschungsdaten für eine Veröffentlichung geeignet, z.B. bei vertraulichen oder datenschutzrechtlich sensiblen Informationen. Forschende entscheiden in eigener Verantwortung über die Veröffentlichung ihrer Daten im Rahmen ethischer Richtlinien und gesetzlicher Regelungen, vgl. den Ansatz der EU-Kommission zur Veröffentlichung von Forschungsdaten „as open as possible, as closed as necessary“.
Als offene Lizenzen für Forschungsdaten stehen beispielsweise die Lizenzmodelle von Creative Commons (CC) (ab Version 4.0 geeignet für Forschungsdaten) oder die GNU General Public License (GPL) (für Software) zu Verfügung.
Unterstützung bei der Auswahl von offenen Lizenzen bieten folgende Ressourcen:
- License Chooser (für Creative Commons Lizenzen)
- License Selector Tool (von B2SHARE / EUDAT Collaborative Data Infrastructure)
- Präsentation „Daten lizenzieren“ von Peter Brettschneider
- Was ist eine Autor:innenidentifikation?Einklappen
-
Persistente Autor:innenidentifikatoren gewährleisten die eindeutige Zuordnung von (Daten-) Publikationen zu den Autorinnen und Autoren auch bei Namensänderungen oder unterschiedlichen Schreibweisen. Dadurch tragen sie zur Verbesserung der Sichtbarkeit der eigenen Forschungsaktivitäten bei.
Identifier für Autorinnen und Autoren:
- ResearcherID: plattformspezifischer Identifier für das Web of Science (WoS), der automatisch für eine/n Autor:in vergeben wird, sobald eine Publikation im WoS verzeichnet wird.
- Scopus Author ID: plattformspezifischer Identifier für Scopus, der automatisch generiert wird, sobald eine Publikation in Scopus verzeichnet wird.
- Gemeinsame Normdatei (GND) - ID: Die GND weist Normdaten unter anderem für Körperschaften, Konferenzen und Personen nach. Sie wird von der Deutschen Nationalbibliothek (DNB) sowie Bibliotheksverbünden und weiteren Einrichtungen gemeinsam bearbeitet. Eine GND-ID für Personen kann in der OGND oder im GND Explorer (Beta) recherchiert werden.
- Open Researcher and Contributor ID (ORCID): Das eigene ORCID-Profil muss von den Forschenden selbst angelegt und administriert werden. Die Forschenden behalten Kontrolle über ihre Daten und deren Zugänglichkeit. Mit der ORCID ID können die bibliographischen Daten zu Forschungsdaten und Publikationen aus verschiedenen Quellen im ORCID-Profil zusammengeführt und die Publikationsliste an einem zentralen Ort verwaltet werden. Die ORCID ID ist eine 16-stellige persistente Identifizierungsnummer, die plattformübergreifend verwendet werden kann. Verschiedene Personen-Identifier können dem eigenem ORCID-Profil zugefügt werden.
Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten zur Autor:innenidentifikation der UB. Die Vergabe von persistenten und eindeutigen Identifikatoren für Autorinnen und Autoren gewinnt zunehmend an Bedeutung und wird bereits bei einigen Verlagen oder Forschungsdatenrepositorien im Einreichungsprozess erwartet. Die Verwendung von ORCID als plattformübergreifendes und nicht proprietäres System wird von der Universität Bayreuth empfohlen.
- Was ist beim Zitieren von Forschungsdaten zu beachten?Einklappen
-
Das Zitieren von Forschungsdaten ist Teil der guten wissenschaftlichen Praxis. Umfassende Hinweise und Prinzipien zum Zitieren von Forschungsdaten für Datennutzende, Datenautorinnen und Datenautoren sind auf den Seiten "Zitieren von Daten" der Initiative forschungsdaten.info zusammengestellt.
- Was bedeutet Data Sharing und welche Vorteile bietet es?Einklappen
-
Daten teilen (Data Sharing) bedeutet, dass die Daten anderen zur Verfügung gestellt werden, heißt aber nicht notwendigerweise, dass die Daten öffentlich für alle zugänglich sind (open data). Daten können auch mit Zugangsbeschränkungen geteilt werden, beispielsweise erst nach einer Registrierung, mit zusätzlicher Anfrage beim Datengebenden vor Weitergabe der Daten oder mit einer Embargofrist. Diese Optionen sind abhängig vom Repositorium. Sollten spezielle Zugangseinschränkungen benötigt werden, ist es daher sinnvoll, sich frühzeitig über geeignete Repositorien zu informieren.
Entsprechend der Leitlinien der Universität Bayreuth zum Forschungsdatenmanagement entscheiden Forschende der Universität Bayreuth in eigener Verantwortung innerhalb des rechtlichen Rahmens und unter Berücksichtigung der Gepflogenheiten des Faches ob, zu welchem Zeitpunkt und unter welchen Bedingungen sie ihre Forschungsdaten zugänglich machen. Die Universität empfiehlt ihren Angehörigen gemäß den Grundsätzen zum Umgang mit Forschungsdaten der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen vom 24. Juni 2010 und der Stellungnahme der G8-Wissenschaftsminister vom 12. Juni 2013, Forschungsdaten möglichst frühzeitig öffentlich zugänglich zu machen.
Das Teilen und Veröffentlichen von Forschungsdaten auch ausserhalb der eigenen Arbeitsgruppe ist mittlerweile auch in den Open Science Anforderungen einiger Förderer implementiert und
- fördert den wissenschaftlichen Diskurs und Transparenz (offene Wissenschaftskultur)
- fördert wissenschaftliche Innovation (Nachnutzung der Daten, neue oder ergänzende Hypothesen)
- stärkt die wissenschaftliche Integrität
- ermöglicht neue Kooperationen weltweit
- erhöht Sichtbarkeit der Forschungsergebnisse
- reduziert Kosten
- Welche Gründe gibt es, Forschungsdaten nicht zu teilen?Einklappen
-
Nicht immer sind Forschungsdaten für eine Veröffentlichung geeignet, z.B. bei vertraulichen oder datenschutzrechtlich sensiblen Informationen. Forschende entscheiden über eine Veröffentlichung der Daten im Rahmen ethischer Richtlinien und gesetzlicher Regelungen, vgl. den Ansatz der EU-Kommission „as open as possible, as closed as necessary“.
Mögliche Gründe, die das Teilen von Daten einschränken oder sogar verhindern, sind:
- Daten haben kommerziellen Wert: ein Patent ist/wird beantragt
- Daten sind aus Sicherheitsgründen sensibel
- Daten sind persönlicher/vertraulicher Natur (Datenschutzregelungen, DSGVO)
- Lizenzvorgaben, die das Teilen von Daten nur unter bestimmten Bedingungen erlauben
- Verträge mit Dritten, die das Teilen von Daten einschränken oder nicht erlauben
- andere sensible Informationen (vgl. z.B. Publikation zu Biodiversitätsdaten)
Einen umfassenden Überblick zu rechtliche Fragen bei Forschungsdaten mit weiterführenden Informationen zum Datenschutzrecht und Urheberrecht hat die Initiative forschungsdaten.info im Themenkomplex „Rechte und Pflichten“zusammengestellt, darunter auch eine Entscheidungshilfe zu den wichtigsten rechtlichen Aspekten bei der Veröffentlichung von Forschungsdaten.
Unterstützung zu rechtlichen Fragen bei der Veröffentlichung von Forschungsdaten bietet auch der Entscheidungsbaum "Urheberrechtliche Fragestellungen für die Veröffentlichung von Forschungsdaten" (Stand 12/2020) der TU Dresden. - Wie können sensible Informationen in Repositorien geschützt werden?Einklappen
-
Abhängig von den Funktionalitäten der Repositorien gibt es verschieden Möglichkeiten, den Zugang zu sensiblen Daten einzuschränken:
- Unterzeichnung einer allgemeinen Nutzungsvereinbarung (z.B. ausschließlich für wissenschaftliche Zwecke) oder andere Lizenzvereinbarungen
- Zugang wird auf registrierte Nutzerinnen und Nutzer eingeschränkt
- Zugang wird erst nach Zustimmung durch den Datengebenden gewährt
- Daten werden für einen bestimmten Zeitraum unter ein Embargo gestellt
- Bei sehr sensitiven Daten können auch nur die Metadaten (eine Beschreibung der Daten) veröffentlicht werden; der Datenzugang ist nur vor Ort im Safe Room/on-site erlaubt
Beispiele für Archive/Repositorien mit abgestuften Freigabekonzepten oder Safe Room:
Unser Beratungsangebot nach Abschluss des Projekts
In Kooperation von Forschungsförderung, Universitätsbibliothek und IT-Servicezentrum gibt es an der UBT folgende Angebote:
- Beratung zur Veröffentlichung und Nachnutzung von Forschungsdaten (Repositorien, Datenjournale)
- DOI Vergabe für die Publikation von Forschungsdaten an der Universität
- Beratung zur langfristigen Verfügbarkeit von Forschungsdaten (Metadatenvergabe, Archivierung, Nutzung von RADAR)
Weiterführende Informationen
- (Fach)Repositorien zur Publikation und ArchivierungEinklappen
-
Science Europe
OpenAIRE
re3data
DataCite Commons
DFG
Open Access Directory (OAD)
RADAR
- Langfristige SpeicherungEinklappen
-
NFDI
lzv.nrw
- FAIR-PrinzipienEinklappen
-
GO FAIR
OpenAIRE